
Die Digital Audio Workstation hat als Software die Musikproduktion revolutioniert. Was zuvor nur in kostspieligen Studios umsetzbar war, konnten Musiker plötzlich auch eigenständig realisieren. Hier kommt eine Übersicht für Anfänger, was eine DAW ist, kann und können sollte.
Check it: Was ist eine DAW?
- Definition der Digital Audio Workstation
- Wie der Begriff sich in Jahrzehnten gewandelt hat
- Was der technologische Fortschritt bedeutete
- Wie die Software die Musikproduktion revolutioniert hat
- Warum die Musikindustrie nicht profitiert hat
- Was eine DAW können sollte
- Verarbeitung von Audiodaten und MIDI-Protokoll
- Erweiterung mit Plug-in-Effekten und VST-Plugins
Definition: Was ist eine DAW?
DAW ist eine Abkürzung für Digital Audio Workstation. Sehr vereinfacht ausgedrückt handelt es sich dabei um eine Software zur Aufnahme, Bearbeitung und Produktion von Musik. Und zwar für den kompletten Prozess der Musikproduktion, begonnen beim Einspielen digitaler Audiodaten, über Erstellung von Beats, Grooves, Melodien, Hooks und Harmonien mit virtuellen Instrumenten bis zur Optimierung des Sounds über die unterschiedlichsten Effekte und schlussendlich das Mischen und sogar Mastern des Songs.
Ein Begriff im Wandel der technischen Entwicklung
Die Begrifflichkeit hat sich im Laufe der Jahrzehnte in seinem Selbstverständnis geändert. In Zeiten der großen Tonstudios verstand man darunter den „(…) kompletten Verbund digitaler Geräte für die Aufzeichnung und Verarbeitung von Schallsignalen bei Tonaufnahmen über den gesamte Produktionsprozess hinweg.

Später beanspruchten die Harddisc-Recording-Geräte die Bezeichnung für sich, die schon mehr und vor allem kompakten Komfort bei der Aufnahme boten, solange HD-Recording auf PC oder Mac noch nicht zur Verfügung stand. Dann gab es eine Zeit, in der man die Computer selbst als DAW bezeichnete, sofern sie für Audio-Anwendungen optimiert waren. In unserem aktuellen Zeitalter mit fortschreitender Digitalisierung und immer leistungsfähigeren Geräten ist es üblich, insbesondere die Musiksoftware, die quasi als kompletter Tonsstudioersatz herhält, als DAW zu bezeichnen.
Ein Blick in die Geschichte
Tonstudios in denen zahlreiche und höchst kostspielige Komponenten für Aufnahmen zusammengefasst werden mussten, gab es bekanntlich schon weitaus länger. Aber die Geschichte der DAW als digitale Kommandozentrale in der Musikproduktion beginnt letztlich in den 1980er-Jahren. Als erste Digital Audio Workstation wurde das Synclavier bezeichnet, das von 1975 bis 1991 hergestellt wurde.
Erster Synthi mit integrierter Sampling-Technik
Der erste Synthesizer mit integrierter Sampling-Technik war der Fairlight CMI, der 1979 auf dem Markt kam. Tatsächlich war er damals eines der teuersten Musikinstrument überhaupt, präsentierte sich als eine der ersten Musikproduktionsworkstations und avancierte seit den Endsiebzigern zum Traumgerät aller Keyboarder und Produzenten. Für die allermeisten sollte es aufgrund der horrenden Preise beim Traum bleiben.

Aus der Zeit, in der es noch Telefonzellen gab
Zur zeitlichen Einordnung: Das erste Handy der Welt kam mit dem Motorola Dynatac 8000X im Jahr 1983 auf den Markt, kostete 4.000 US-Dollar und wurde innerhalb eines Jahres mehr als 300.000 Mal verkauft. Tatsächlich gab es noch sogenannte Telefonzellen. Das waren kleine, enge und meistens ziemlich stinkende Häuschen mit etwa einem Quadratmeter Grundfläche.
Konstruiert waren die mit oftmals eingeschlagenen Fenstern und in den Zellen hing ein großes Münztelefon. Wollte man telefonieren, musste man ein paar Münzen hineinwerfen. Wenn man Glück hatte, war sogar der Telefonhörer noch nicht abgerissen. Und bei richtigem Glück hingen unter dem Telefon noch ein paar gelbe dicke Bücher, mit denen man rausbekommen konnte, welche Nummer man für ein bestimmtes Ziel zu wählen hatte. Ach ja … nicht in verstaubte Zeiten ablenken. Wir wollen uns mit der DAW beschäftigen.

Wie die DAW die Musikproduktion revolutioniert hat
Die DAW als Musiksoftware hat die Musikproduktion bis in die heutigen Tage nicht nur beeinflusst, sondern förmlich revolutioniert. Der immense Vorteil ist, dass mit überschaubarem finanziellen Einsatz Musik von nahezu jedem im Heimstudio aufgenommen, bearbeitet und bis zum Endresultat produziert werden kann. Genau das war eben lange Zeit schlichtweg unmöglich; die Produktion war ausschließlich den finanzkräftigen Studios vorbehalten.

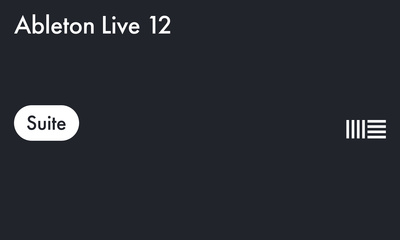
Problematik waren die begrenzten Speicherkapazitäten
Einher ging die Entwicklung mit den evolutionären Fortschritten von Computertechnologie und Digitalisierung. Waren zuvor für die Aufnahme, das Schneiden und erneute Verkleben und punktgenaue Überspielen reichlich Hardwarekomponenten und versierte Techniker nötig, wurden die Computer langsam (und dann immer schneller) leistungsfähiger.
Die ehemalige Problematik beim Übergang von der analogen in die digitale Welt waren die überaus dürftigen Speicherkapazitäten, die Geschwindigkeit der Speichermodule und somit langsamen Rechenzeiten. Das sollte sich alsbald geradezu rasant ändern.
Die großen Tonstudios bekamen Probleme
Zu behaupten, insbesondere die Tonstudios hätte von dieser Entwicklung profitiert, ist möglicherweise der falsche Ansatz; schließlich verloren sie dadurch einen Großteil ihrer Ausnahmestellung. Tatsächlich hatten etliche Tonstudios in Tonnen von höchst kostspieligem Equipment investiert, das im Grunde genommen innerhalb kürzester Zeit immens an Wert verlor.
Eine einzige DAW konnte ein komplettes Studio ersetzen
Die wahren Gewinner waren diejenigen, die sich bis dahin Produktionen in Eigenregie schlichtweg nicht leisten konnten. Die konnten nunmehr mit vergleichsweise geringen Mitteln loslegen. Spätestens nachdem die DAWs mit immer mehr Tools und Funktionen befrachtet wurden. Eine einzige Digital Audio Workstation konnte ein komplettes Studio ersetzen.

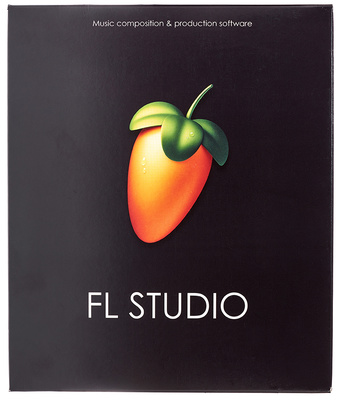
Kostenlose Programme bieten eingeschränkte Funktionalität
Selbstverständlich existieren bei den Anbietern von Musiksoftware diverse Unterschiede hinsichtlich der Funktionalität, Ausstattung und Bedienbarkeit. Auch gibt es kostenlose Programme, mit denen schon einiges machbar ist, in den meisten Fällen allerdings ziemlich eingeschränkt. Verbleibt die Frage, was eine aktuelle DAW können sollte, ohne gleich preislich nach den Sternen zu greifen.
Sequenzer-Software als Vorläufer der DAW
In den 80ern erschienen die ersten wirklich professionellen MIDI-Sequenzer als Software für den Atari-ST-Computer. Warum ausgerechnet der? Weil er die MIDI-Schnittstelle sogar schon eingebaut hatte, erschwinglich und mit Zusatzgeräten einfach um weitere MIDI-Schnitstellen erweiterbar war. Zu den bekanntesten Programmen gehörten damals C-Lab Creator/Notator (ab 1987, das ist der Vorläufer von Apple Logic!) und Steinberg Cubase (ab 1989).
Damals musste man für Audio zwar noch eine Bandmaschine oder einen Hardware-Sampler einsetzen, aber das sollte sich wenige Jahre später ändern. Denn zunächst gab es ab den frühen 90ern die Möglichkeit, Audiospuren direkt im Sequenzer aufzunehmen, dort zu schneiden und zu verändern. Das nannte sich dann Harddisk-Recording. Aber bitte schön ging das zunächst nur, indem man alles erst einmal berechnen ließ und sich dann das Ergebnis anhören konnte.
Was eine DAW können sollte
Als komplexe Programme mit unterschiedlichsten Funktionen für Musikproduktion und Tonaufnahme, sind DAWs oftmals auf spezielle Genres oder Kernanwendungen optimiert. So versteht sich beispielsweise Pro Tools als Anwendung für klassisches Recording und Mixing. Auch Steinberg Nuendo ist so eine Software. Die andere Seite, nämlich die der Livemusiker und DJs, bedient etwa Ableton Live. Der Name des Programms trägt die Bedeutung bereits in sich, aber auch die Entwicklung neuer Songs ist hier möglich.
Software wie Cubase oder Logic verstehen sich als Kompositions-Tools, in denen man Songs vom berühmten weißen Blatt Papier – hier meist ein fast leerer grauer Bildschirm – entwickelt und zum Schluss eine komplett fertige Produktion erhält. Und auch diese DAWs habe ich schon auf den Bühnen dieser Welt gesehen.
Aufbau einer DAW
Die meisten DAWs haben ein zentrales Arrangement-Fenster, in dem du den Aufbau deines Songs sehen und bearbeitest. Manche DAWs, etwa Ableton Live, haben auch die Möglichkeit Songs über das Verketten von Loops zu erstellen und haben dafür eine spezielle Ansicht.
Dazu kommen verschiedene Editor-Fenster zur Bearbeitung von MIDI- und Audio-Daten. Du kannst dir die Töne in Balken anzeigen lassen, in Beat Grids (perfekt für Drums) oder in Noten, die manchmal sogar in druckfähiger Qualität bearbeitet werden können.
Audio-Daten wiederum können im Arrangement nicht-destruktiv (ohne dass du die Originaldatei auf der Festplatte veränderst) verschoben oder geschnitten werden und auch destruktiv manipuliert, etwa normalisiert oder in Tempo und/oder Tonhöhe verändert werden.
Für welche DAW du dich auch entscheidest, wichtig ist, dass du dich mit der Art und Weise, wie sie arbeitet, wohl fühlst. Denn im Funktionsumfang sind die Topversionen der verschiedenen DAWs alle ähnlich, aber die Herangehensweise ist oftmals doch recht unterschiedlich.
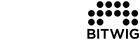

Verarbeitung von Audiodateien
Grundlegend wichtig bei allen DAWs ist die Verarbeitung von Audiodateien. Um die einzuspielen, gibt es zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Die erste ist, sie über ein Mikrofon aufzunehmen, so beispielsweise die Stimme oder akustische Instrumente. Ebenso können Instrumente wie Hardware-Synthesizer und dank Hi-Z-Eingängen an Audio-Interfaces auch E-Gitarre und E-Bass angeschlossen und aufgenommen werden.
Nutzung von Samples auf den Audiospuren
Die zweite und sehr häufig genutzt Variante ist die Verwendung von Samples – vorhandene oder eigens erstellte Audiodateien, die einfach auf die Audiospuren gelegt oder über entsprechende Software-Sampler abgespielt werden. Lediglich eines der klassischen Beispiele sind die Drum-Tracks und Drum-Sounds, mit denen die Grooves im Heimstudio auf Basis von Samples ohne ein echtes Instrument gebaut werden.
MIDI als das noch immer angesagte Kommunikationsprotokoll
MIDI ist als Datenformat beileibe keine neue Sache und hat schon einige Jahre auf dem vielzitierten Buckel. Schon 1983 kamen die ersten serienmäßig mit MIDI ausgestatteten Synthesizer auf den Markt, der erste war der Roland Jupiter-6. Unbesehen dessen gehört MIDI bis heute zu den wichtigsten Werkzeugen in der Musikproduktion. MIDI steht für „Musical Instrument Digital Interface“; übersetzt: Digitale Schnittstelle für Musikinstrumente. Damit steuern DAWs auch heute noch externe Geräte. Und auch intern werden viele Plug-ins über dieselben MIDI-Controller-Werte gesteuert wie noch in 80ern.
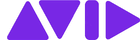

Die Sprache, in der sich Maschinen unterhalten
Mit etwas Fantasie liegt man nicht allzu verkehrt, dieses Format als Sprache, sogar als Kommunikationsmedium zu bezeichnen. Immerhin erlaubt das MIDI-Protokoll Musikinstrumenten, Computern und Hardware miteinander zu kommunizieren.
MIDI-Option ist eigentlich DAW-Standard
Auf den MIDI-Spuren innerhalb der DAW können Beats, Harmonien, Melodien, Patterns oder auch kurze Fragmente programmiert und anschließend von einem MIDI-fähigen Instrument wie einem Synthi oder einem Drum-Computer wieder abgespielt werden. Dieses „Instrument“ kann wiederum eine haptische Hardware oder auch „nur“ eine Software in Form eines Plug-ins sein. In der Realität gibt zwar MIDI-Keyboards ohne DAW, aber vermutlich keine DAW ohne MIDI-Option.
Nur, damit wir uns hier richtig verstehen: Die alte MIDI-Schnittstelle war und ist seriell. Das bedeutet, dass alle Befehle immer nur nacheinander, aber nie wirklich gleichzeitig übertragen werden können, was moderne MIDI-Interfaces und auch Controller-Keyboards mit USB-Schnittstelle gut im Griff haben. Auch wenn moderne DAWs mit MIDI-Spuren und Controller-Daten arbeiten, läuft die Kommunikation im Rechner von der DAW zu den Plug-ins längst parallel ab.


Durch Plug-in-Effekte wird die Software erweitert
In der Regel werden Aufnahmen bzw. Produktionen anfangs „trocken“, also ohne Effekte aufgenommen und erst dann mit Effekten veredelt. Nur folgerichtig sollte die DAW etwa Equalizer, amtlichen Hall, Kompressoren ebenso mit an Bord haben wie auch Echo und diverse weitere Modulationsoptionen. Diese Effekte zur Bearbeitung der bis dato trockenen Signale werden in der Regel in Form von Plug-ins realisiert.
Plug-ins muss man sich vorstellen als zusätzliche Programme von Drittanbietern, die bei einer DAW als Add-on installiert werden können; die DAW wird also um Zusatzinstrumente oder Audioeffekte und Werkzeuge erweitert. Das dahinterstehende Ziel ist es, dass kreative Potenzial noch besser nutzen zu können. Viele DAWs kommen übrigens direkt mit vielen eingebauten Effekten und Klangerzeugern. Die fühlen sich bei der Bedienung genauso an wie zusätzlich installierte Plug-ins, sind aber oft in den Programmcode bereits integriert und gehören somit fest zur Software.
VST als Meilenstein für DAWs
Die Hamburger Firma Steinberg zählt bis heute zu den großen Pionieren und ermöglichte mit der Erschaffung des VST-Formats, VST steht für Virtual Studio Technology, im Jahr 1996 erstmals den Einsatz von Echtzeit-Plug-in-Effekten im Rechner ohne dass zusätzliche Hardware benötigt wurde. Zunächst gab es die VST-Schnittstelle nur für Cubase, doch recht schnell entwickelte sie sich zum einem Standard und wurde von vielen DAW-Herstellern genutzt.
Mit der Einführung von VST2 i, Jahr 1999 konnten VST-Plug-ins auch MIDI-Effekte empfangen – das war der Startschuss für die ersten VST-Instrumente, von denen es inzwischen die verschiedensten Varianten gibt.
Inzwischen gibt es auch andere Plug-in-Formate, die mit VST konkurrieren. Auf dem Mac gibt es das AU-Format, dabei steht AU für Audio Unit und es gibt ebenfalls zahllose Effekte und Instrumente. Ein weiters Beispiel ist das CLAP-Format (CLever Audio Plug-in), das es auf Mac und PC gibt. Das Open-Source-Format wurde von den Berliner Firmen u-he und Bitwig entwickelt. Es gibt es erst seit 2022 und steht noch am Anfang seiner Entwicklung, ist aber bereits sehr leistungsstark.

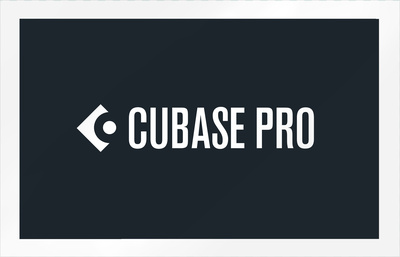
Zusätzliche Funktionalität mit diversen Anwendungen
Grundlegend wurden VST-Plug-ins geschaffen, um neue Effekte oder Instrumente für die Bearbeitung des Audiomaterials zur Verfügung zu stellen, mit denen die DAW von Haus aus zunächst nicht ausgestattet ist. Dabei gibt es natürlich endlos viele Möglichkeiten bzw. Anwendungswünsche der Musiker und Musikproduzenten. Und so kann man inzwischen nahezu alle legendären Hardware-Effektgeräte auch als mal hervorragende, mal „geht so“ Emulationen in Plug-in-Form kaufen. Und auch Effekte, die als Hardware so nicht möglich sind, gibt es als Software.
Autotune als berüchtigtes Korrekturbeispiel
Lediglich eines der vielen Beispiele ist etwa Autotune, das berüchtigte Werkzeug, bei dem die Welt sich nie einig sein wird, ob man es einsetzen darf oder nicht. Mit Autotune kann die Tonhöhe eines Signals korrigiert werden. In der Vergangenheit wurde das zumeist eingesetzt, um weniger perfekt eingesungene Passagen geradezurücken. („Ich kann mich nicht hören!“ … „Sei froh!“) Darf man derart in die Natürlichkeit der Stimme eingreifen? Meine Antwort: Ja, man darf, denn schließlich machen wir Kunst. Aber man muss nicht immer!

Imitieren realer Instrumente über VST-Instrumenten-Plug-ins
Dann wiederum gibt es die VST-Instrumenten-Plug-ins, die eine DAW ebenfalls verarbeiten kann. Eigentlich sind das schlichtweg digitale Instrumente, die eben digital nachgebildet bzw. imitiert werden. Zur Wahrheit gehört, dass die ersten VST-Plugins mit Instrumentensounds – nennen wir es mal ganz freundlich – suboptimal waren. Inzwischen haben die allerdings Quantensprünge hingelegt; selbst VST-Konzertflügel sind im Mix von ihren haptisch-natürlichen Kameraden kaum noch zu unterscheiden.
Drittanbieter-Plug-ins
DAWs stellen alle bereits eine eine Vielzahl an unterschiedlichen Instrumenten und Effekten bereit. Auch Sound- und Loop-Bibliotheken sind oft schon mit dabei. Und doch gibt es zahlreiche Drittanbieter, die weitere Plug-ins anbieten. Das geht von Software-Emulationen, die die Originalhersteller von ihrer Hardware anbieten, über Emulationen von Vintage-Gear, die oft sehr nah an die originalen Klassiker rankommen, bis zu ganz eigenständigen Synthis und Effekten, die es nur als Software gibt.
Es lohnt sich, seine DAW nach dem eigenen Sound-Geschmack mit Plug-ins zu individualisieren. Und wenn du ein bisschen weiter bist, wirst du überrascht sein, dass auch die Produktionen aus den Charts ganz oft mit den Plug-ins gemacht wurden, die du in deiner DAW hast.
Auch interessant: „Latenz – ein Phänomen, das verstanden werden will“






