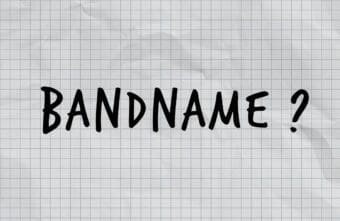In der musikalischen Formenlehre werden Strukturen und Abläufe definiert. Zwangsläufig bedeutet das ein gewisses Korsett für die Kompositionen; auf der anderen Seite auch die Möglichkeit der Einordnung von Begrifflichkeiten und Abläufen. In dieser Folge widmen wir uns einer weiteren Ausdrucksform innerhalb der klassischen Musik: Was ist eine Kantate?
Check it: Verstehen der Formen: Was ist eine Kantate?
Definition: Was ist eine Kantate
Grundsätzlich ist eine Kantate ein lyrisches Gedicht, das in verschiedene abwechselnde Sätze unterteilt und mit instrumentaler Begleitung gesungen wird. Hauptbestandteile sind die sich abwechselnden Sätze der Arie in ihren diversen Facetten, das Rezitativ sowie das Arioso, wobei insbesondere bei den größeren Werken die Chöre als stützendes Element genutzt werden. Gekennzeichnet ist die Kantate durch die Folge von fünf bis neun durchkomponierten Strophen eines freien Textes über den gleichbleibenden Bass.
Es geht um klerikale und abstrakte Inhalte
Das allerdings ist noch kein Alleinstellungsmerkmal der Kantate, vielmehr treffen diese Attribute ebenso auf Opern und Oratorien zu. Konkreter definiert sich die Kantate über die texturierten Inhalte. Bei Oper und Oratorium geht es um Handlungen, in der Kantate um Emotionen und Gedanken über Gott und Religion, die vorherrschende Moral und weitere abstrakte Themen.
Musikalisches Entwicklungskarussell
Üblich war es in vergangenen Epochen, dass sich weltliche Musik aus kirchlicher Musik entwickelte, wofür es zahlreiche Beispiele gibt. Bei der Kantate war das tatsächlich umgekehrt. Im frühen Barockzeitalter – ab etwa 1600 – entwickelte sich die zunächst weltliche Kantate in Italien. Dann ging’s in die Adelshäuser, in den Gottesdienst und irgendwann alles wieder umgekehrt. Die Kantate war das musikalisch personifizierte Entwicklungskarussell.
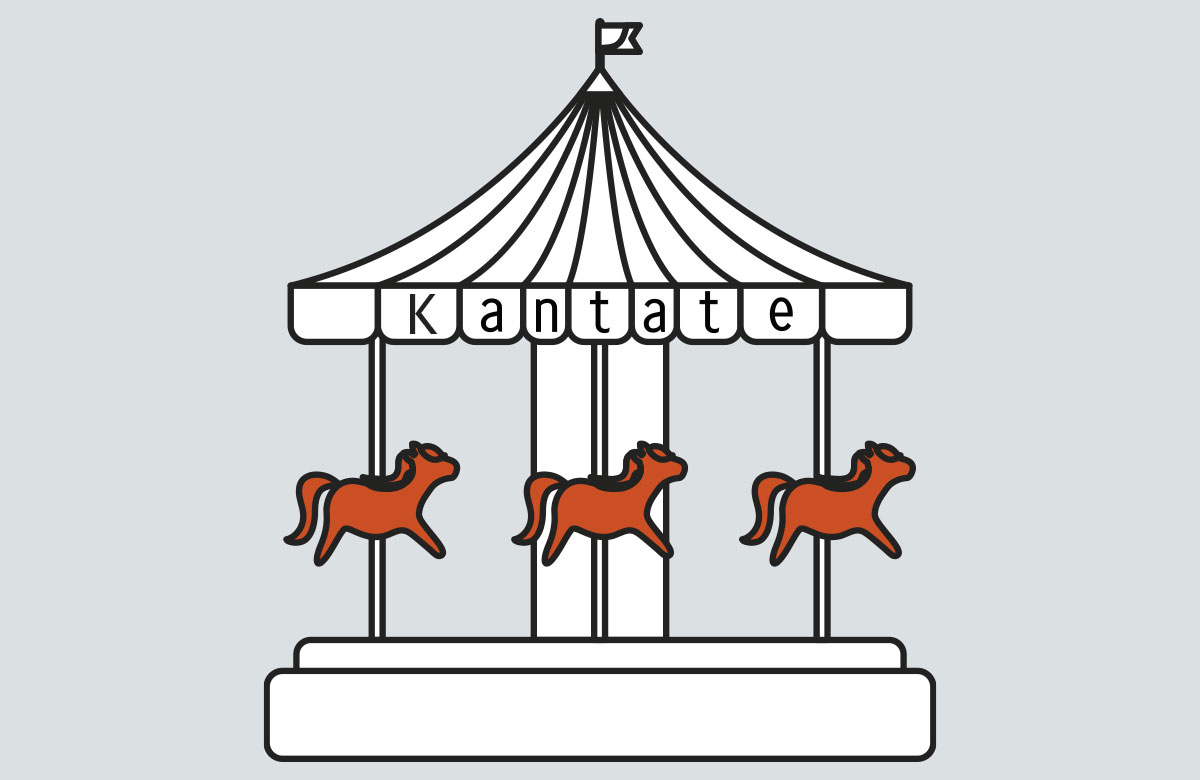
Konzentration auf strophisch mehrstimmigen Gesang
Prägende Merkmale waren der strophische Gesang für eine oder auch mehrere Gesangsstimmen, wobei jede Strophe mit einer anderen oder zumindest variierten Melodie komponiert war, und der stets gleichbleibende Bass, der in der musikalischen Fachsprache als Basso Continuo bezeichnet wird. Die Melodie der Singstimme, war häufig kunstvoll, aber stets ganz eng an Text und Thema komponiert.
Was ist ein Rezitativ
Beim Rezitativ erzählt oder spricht ein Erzähler einen Textausschnitt mit sich weiterentwickelnder Handlung. Obschon dieses Rezitativ meistens gesungen wird, orientiert sich insbesondere die Betonung wie beim Vorlesen an der Satz- und Sprachführung. So wird die Stimme etwa beim einem Punkt am Satzende abgesenkt, bei einem Fragezeichen angehoben.
Kantate als Bestseller im Barock
Heutzutage am bekanntesten und besonders präsent als Form der Kantate ist insbesondere die deutsche Kirchenkantate. Im 17. Jahrhundert wurde die klerikale Form bei den damaligen Komponisten zunehmend beliebter. Plötzlich gab es kaum Komponisten, die keine geistlichen Kantaten mit entsprechend bedeutender Rolle des Chores schrieben. Zu den Besonderheiten zählte in dieser Zeit, dass Rezitative in der kirchlichen Kantate seltener bis gar nicht vorkamen.
Weitere Transformation zum klerikalen Höhepunkt
Das sollte sich alsbald ändern, nämlich etwa ab dem Jahr 1700, dem Übergang ins 18. Jahrhundert. Mag sein, diese Musikform näherte sich dem geistlichen Höhepunkt, zumal der Pfarrer Erdmann Neumeister ein komplettes Buch mit Kantaten-Libretti für den Gottesdienst herausgegeben hatte. Und eben die waren deutlich in liedhafte und rezitativische Teile gegliedert.

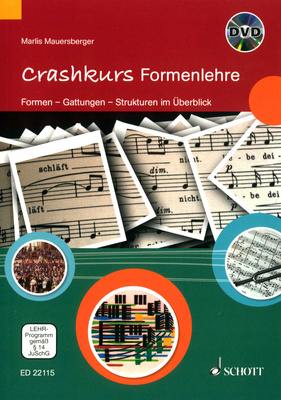
Bach als Workoholic der Kirchenkantaten
Vertont wurden die beispielsweise von Johann Sebastian Bach, der zudem mehr als 200 Kirchenkantaten für die Gottesdienste zu jeweils speziellen Tagen schrieb. Für Bach waren Rezitative eine Selbstverständlichkeit. Für die richtige Einordnung müssen wir verstehen, dass der Text die höchste Bedeutung hatte; die Musik ordnete sich in diesem Sinne dem Wort unter.
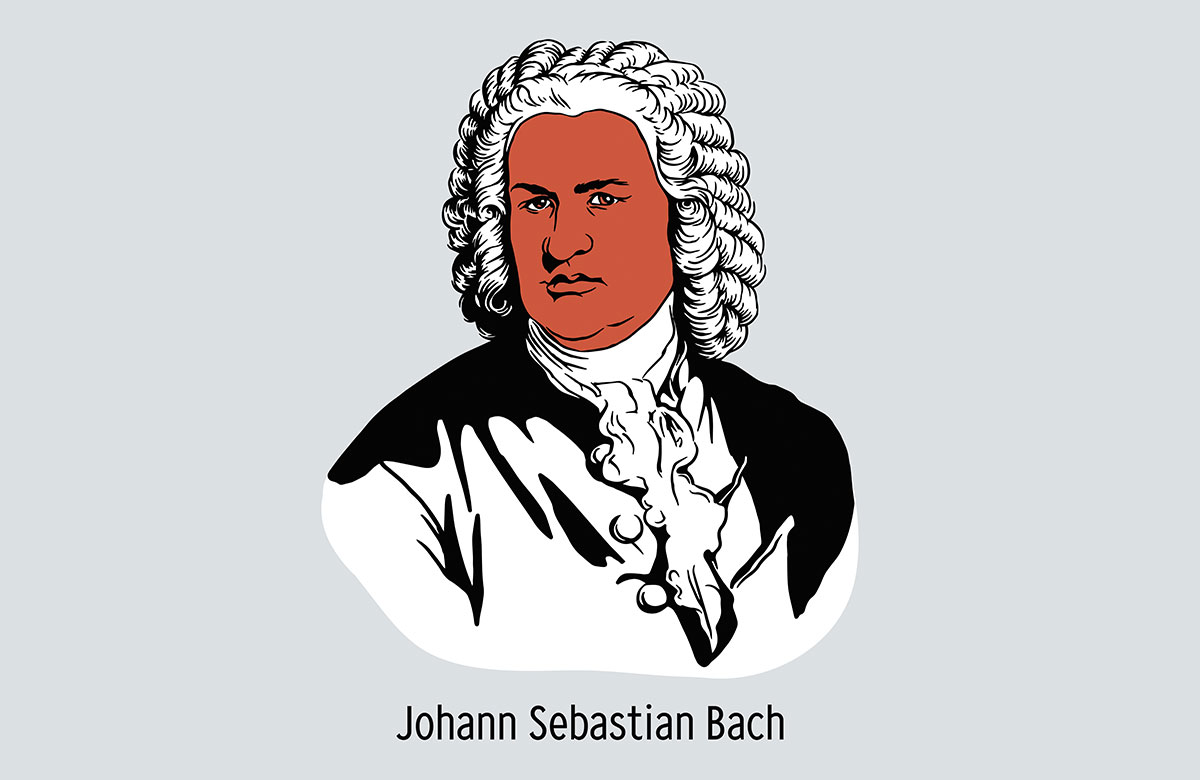
Hohe Bedeutung der Textverständlichkeit
Zwangsläufig bedeutete das, dass der Text unbedingt verstanden werden musste. Das galt für die Kirchengemeinde damaliger Zeit, weshalb etwa auf Koloraturen nahezu vollständig verzichtet wurde, und gilt gleichermaßen für die Musiker, die Kantaten heutzutage interpretieren.
Die weltliche Kantate und der Einfluss der Kirche
Wie bereits anfangs angedeutet, entwickelte sich die kirchliche Kantate aus der sogenannten weltlichen Kantate. Bei der standen eben nicht die vordringlich religiösen Inhalte im Mittelpunkt. Das zeigte dann auch diverse fragwürdige Auswüchse bereits während des blutigen 30-jährigen Kriegs, bei dem die Ungläubigen katholisiert oder rekatholisiert werden sollten und die Kirchenoberen die Kantate ausschließlich für ihre Zwecke beanspruchen wollten.

Von der Kirche geholt und wieder verdrängt
Es sollte aber noch ungefähr ein Jahrhundert dauern, nämlich bis zur zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, als sich die Kritik gegen die Kantaten-Dichtung und den opernhaften, nicht kirchlichen Charakter der Musik verstärkte. Tatsächlich wurde die Kantate im Gottesdienst seit dem frühen 19. Jahrhundert durch den einfachen Choralgesang verdrängt.
Kulturelle unterschiedlich eingesetzt
Dabei gab es ohnehin regionale bzw. nationale Unterschiede. So galt die weltliche Kantate im Frankreich des 17. und 18. Jahrhundert in erster Linie als eine Gattung der Dichtung, die in der Regel in zwei kleinformatige Arien verpackt wurde, wobei die letzte der beiden Arien die Moral der Erzählung enthielt. Aus Italien überliefert ist die Cantata mit vergleichsweise geringerer Bedeutung, hauptsächlich genutzt in der Form als Gelegenheits- oder Glückwunschkomposition bei Hof, die schlussendlich auch unter der Bezeichnung Serenata bekannt ist.

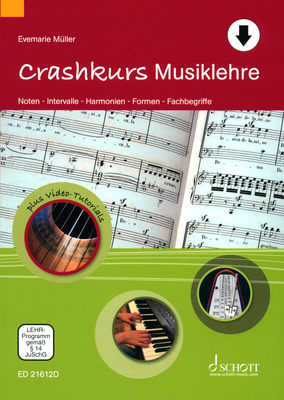
Als den Deutschen die Worte fehlten
In Deutschland sorgte die weltliche Kantate für ein Kuriosum. Entwickelt hatte sie sich zwar im 17. Jahrhundert im Gefolge der Oper. Allerdings konnte sie nicht wirklich Fuß fassen und wurde vor allem aus einem denkwürdigen Grund kaum musikalisch eingebürgert: Es herrschte ein Mangel an geeigneten deutschsprachigen Texten. Wer hätte das gedacht, das stolze Land der Dichter und Denker scheitert an seiner eigenen Sprache.
Die Konzert-Kantate und ihr Höhenflug
Seit etwa 1700 änderte sich an der Struktur der Kantate zunächst kaum noch etwas. Durch den Zerfall der protestantischen Kirchenmusik hielt sie vermehrt Einzug in die weltliche Musik. Vergleichsweise schnell verschwand das sogenannte Secco-Rezitativ. Ebenso änderten sich die thematischen Inhalte als auch die Stilistik, zumindest bei anspruchsvolleren Werken.
Was ist ein Secco-Rezitativ?
Beim Secco-Rezitativ handelt es sich um einen vom Generalbass begleiteten Sprechgesang, bei dem der Sänger den Text rhythmisch frei gestalten, zumal in diesem Part besonders auf Sprachnähe Wert gelegt wird. Der basso continuo gibt lediglich das harmonische Grundgerüst vor. Die ausführenden Musiker improvisieren frei. Die Instrumentierung ist nicht absolut festgelegt. Begleitet wurden und werden Secco-Rezitative etwa durch Cembali, Violoncelli, Gamben oder Pfeifenorgeln.
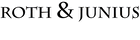



Haydn und Händel als Wegbereiter weltlicher Kantaten
Sehr verehrt wurde in der Zeit der Komponist Joseph Haydn, das „musikalische Universalgenie der Wiener Klassik“. Haydn hatte die verschiedenen Kompositionen der Klassik wie die Sinfonie oder Klaviersonate maßgeblich geprägt und verzeichnete auch großen Erfolg mit seinen Oratorien. Das Gleiche galt für den deutsch-britischen Komponisten Georg Friedrich Händel, dessen Hauptwerk 42 Opern und 25 Oratorien umfasst. Die Beliebtheit u.a. dieser beiden mit dem Fokus auf größere Gesangswerke zog es nach sich, dass eben auch zahlreiche Kantaten geschrieben und schlussendlich als Konzert-Kantaten aufgeführt wurden.
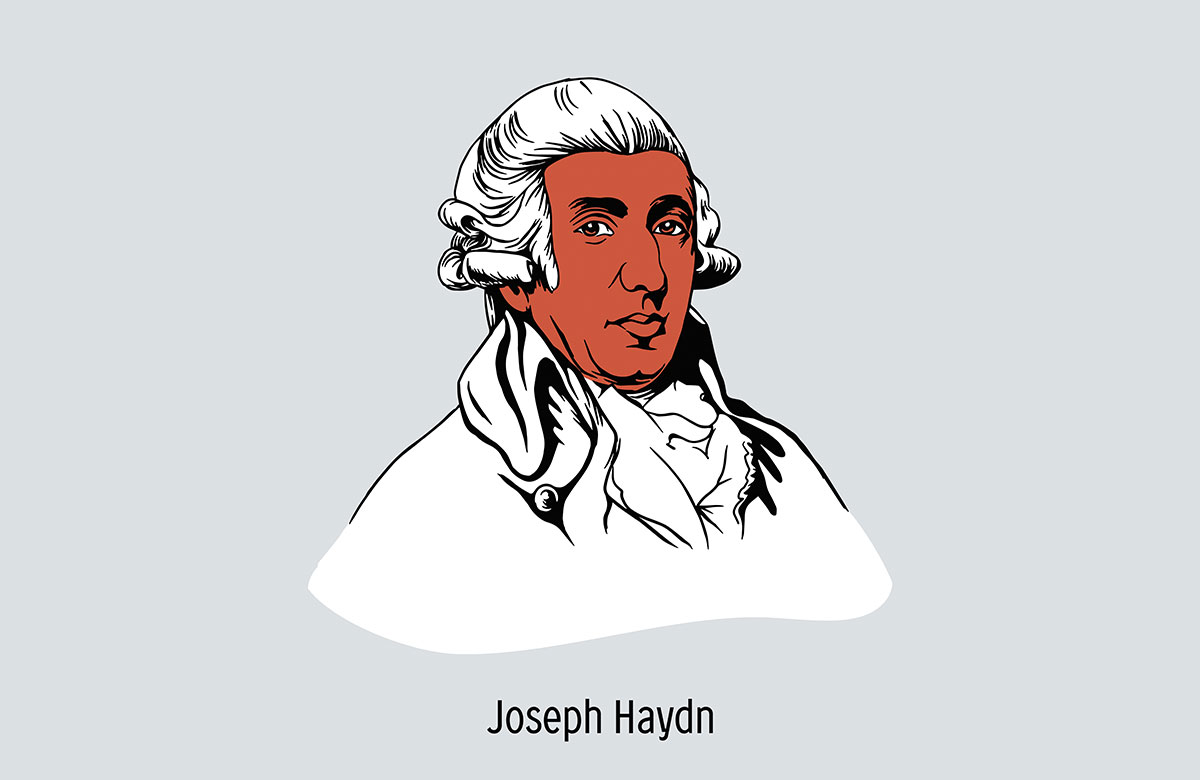
Woher kommt das Wort Kantate
Die Herkunft und Übersetzung zeigt bereits recht unmissverständlich, worum es geht. Die Kantete hat mindestens zwei sprachliche Wurzeln. Zurückführen lässt sie sich im Lateinischen auf den Ausdruck „cantare“, was übersetzt „singen“ bedeutet, noch konkreter auf den lateinischen Imperativ, nämlich „cantate“ – singet! Davon abgeleitet wurde im Italienischen der Begriff „cantata“ mit dem Verb „cantare“. Und schlussendlich erwuchs daraus die deutsche Bezeichnung Kantate. xw
Unterschied zwischen Kantate und Sonate
Die Kantate unterscheidet sich von der Sonate als für Gesang geschriebenes Stück. Im Gegensatz dazu ist die Sonate ausschließlich für Instrumente geschaffen. Der Begriff Sonate ist abgeleitet vom lateinischen „sonare“, was für „klingen“ steht. Spätestens seit dem 16. Jahrhundert ist die Sonate die Bezeichnung für eine instrumentale Komposition, die Kantate demgegenüber für ein Singstück und die „Ballata“ bezeichnet ein Tanzstück.
Unterschied zwischen Kantate und Oratorium
Insbesondere größere Vokalwerke für solistischen Gesang, Chor und Instrumente werden als Kantate bezeichnet. Die Abgrenzung gegen das Oratorium liegt im Text, dem Gestus und musikalisch satztechnischen Haltung sowie der zyklischen Ausprägung.
Unterschied zwischen Kantate und Motette
Anders als bei der Kantate nehmen die Instrumente in der Motette lediglich die Funktion als stützendes Continuo ein, sofern sie überhaupt zum Einsatz kommen. Eine weitere Option der Motette ist, dass die Instrumente – hauptsächlich die Orgel – verstärkend mit den Singstimmen mitgehen. Während es in der Kantate konzertierende Passagen der Instrumente geben kann, entfallen die in der Motette komplett. Die Motette definiert sich als mehrstimmige, in der Regel geistliche Vokalkomposition. Während der Zeit des Gregorianischen Chorals wurde damit vordringlich eine zweite, anders textierte Singstimme bezeichnet.
Der Ruf der Kantate war nicht immer positiv
Auch im 19. und 20. Jahrhundert blieb die Kantate allgegenwärtig, obschon sie ein wenig an Bedeutung verloren hatte. Es waren diverse Sub-Formen entstanden, so auch für die sogenannte Gebrauchsmusik. Mit geradezu abfälligem Nimbus wurde von der „aufführungstechnisch anspruchslosen Kantate für das Gemeinschaftsmusizieren“ gesprochen.

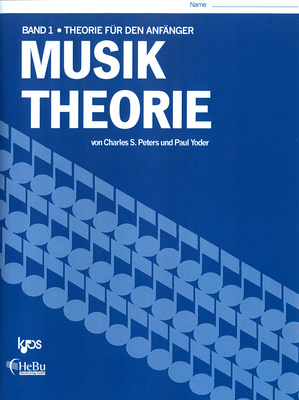
Die neue Musik verarbeitete kritische Themen
Im Zuge der neuen Musik wurde es dann wieder schwergewichtiger, anspruchsvoller und haltbarer. Kompositorisch ergiebig, widmete sie sich hinsichtlich der Textur vielfach gegenwartsnahen Themen bis hin zu politischen als auch militärischen Ereignissen, wobei die Konturen der Gattung – insbesondere die Abgrenzung gegen das Oratorium – als auch das Kammermusiklied nicht mehr so konkret und teils fließend waren.
Es gab zahlreiche Komponisten die in ihrer jeweils eigenen Epoche auf den Form der mit Chor und Orchester größer besetzten Kantate zurückgriffen. Hier ein paar Beispiele:
- Igor Strawinsky – 1882 – 1971
- Anton Webern – 1883 – 1945
- Dimitri Schostakotisch – 1906 – 1975
- Insang Yun – 1917 – 1995
- Bern Alois Zimmermann – 1918 – 1970
- Luigi Nono – 1924 – 1990
Auch interessant: „Musikalische Formenlehre: Was ist ein Oratorium?“