
Begeistert vom speziellen Sound und den Spielmöglichkeiten des rudimentären Synthies im Spielzeuggewand möchtest du eine Otamatone kaufen. Eine gute Idee, immerhin kannst du damit außergewöhnliche Klänge erzeugen und Melodien kreieren, die andernfalls nur mit deutlich kostspieligeren Instrumenten umsetzbar wären, wenn überhaupt. Aber welche darf’s denn sein? Hier unsere Tipps für dich:
Check it: Otamatone kaufen mit einem Hauch von Manga
- Keinesfalls nur Kinderinstrument oder Spielzeug
- Abgespeckter Syntie mit ungewöhnlicher Spieltechnik
- Größen und Qualitätskriterien
- Unterschiedliche Bauweisen
- App, Tonarten und Klangsynthesen
- Spezielle Klangerzeugung der Kaulquappe
- Problematik der exakten Intonation
- Spieltechniken von Portamento bis WahWah
Perspektivwechsel – Otamatone kaufen
Wir Musiker sind nicht selten in unseren eigenen eingefahrenen Perspektiven gefangen. Zur Wahrheit gehört, dass wir uns häufig in einer sehr beengten Blase bewegen, eben den Hörgewohnheiten in unserem regionalen Mikrokosmos. Wer sich hierzulande zum ersten Mal mit der „musikalischen Kaulquappe“ beschäftigt, glaubt sich möglicherweise im Spielzeugregal wiederzufinden. Dabei haben wir das Potenzial der Otamatone in unserer eingeschränkten Sichtweise mindestens verpennt.
Abgespeckter Synthie mit ungewöhnlicher Spieltechnik
Immerhin handelt es sich dabei um einen abgespeckten Synthesizer mit außergewöhnlicher Spieltechnik. Und längst gibt es endlos viele Videos, in denen von Klassik über Volksmusik bis zu Rock und Techno so ziemlich alles serviert wird. Man muss den Blick und die Ohren nur mal aufs Reich der aufgehenden Sonne richten. Nicht zu vergessen, dass die Ovamatone in den angesagten Talent-Shows beispielsweise in England mit Interpretationen von Puccinis‘ Turandot oder in Italien mit Africa ihre spektakulären Spuren hinterlassen hat.

Otamatone kaufen – worauf du achten solltest
Tatsächlich gibt es bei diesem Instrument relativ wenige Aspekte, die über Qualität und Co. entscheiden. Das heißt nicht, dass es keine Aspekte hinsichtlich Verarbeitung und Features gäbe, sondern resultiert vor allem aus der Tatsache, dass es keine Vergleichsmöglichkeiten am Markt gibt, die du als Referenzen heranziehen könntest, falls du eine Otamatone kaufen möchtest. Allerdings gibt es verschiedene Modelle, die sich in ihren Möglichkeiten maßgeblich unterscheiden und für deine Kaufentscheidung ausschlaggebend sein könnten.
Otamatone Melody / Otamatone Mini
Bei diesem Modell handelt es sich um eine sehr spartanische Ausführung. Die Mini-Version besitzt keine Möglichkeit unterschiedlicher Stimmungen oder Noten-Selektionen. Vielmehr gibt dieses Instrument lediglich vorgegebene Stücke wieder. Auch ist dieses Modell recht klein gehalten. Wer nach einem Spielzeug sucht, mit dem kleine Kids zum Musizieren animiert werden, kann durchaus eine solche Otamatone kaufen. Soll die Otamatone Melody als ernsthaftes Instrument genutzt werden, kommt sie allerdings schnell an ihre Grenzen.
Otamatone Classic
Umfangreichere Möglichkeiten bietet die Otamatone Classic. Bereits hier trennt sich die Spielzeugspreu vom musikalischen Weizen. Die Classic-Version des Kaulquappen-Synthies ist gerademal zurückhaltende 26,5 cm lang. Das Auge hört bekanntlich mit. Wenn du eine solche Otamatone kaufen möchtest, hast du die Wahl zwischen verschiedenen Farben von Pink und Weiß bis Schwarz oder Crystal Blau, außerdem stehen weitere Special-Designs wie die Hello-Kitty-Version oder Techno White bereit. Die Classic ist gewissermaßen das Basic-Instrument, das dir die typischen Grundfunktionen bietet, allerdings noch nicht mittels App konfiguriert werden kann. Ideal ist dieses Modell, um beim Home-Recording etwa kleine Sequenzen in Songs mit sehr spezieller Klangvariante einzuspielen.


Otamatone Deluxe
Bei der Otamatone Deluxe handelt es sich um die große Version der Classic. Das Instrument hat bereits eine Länge von 44 cm und stellt an dich somit etwas höhere Anforderungen an die Körperhaltung, die sich jedoch in mehr als überschaubaren Grenzen halten. Ausgestattet ist die Deluxe mit analogem Lautstärkeregler, dreistufigem Pitch-Schalter, Line-Out-Buchse, wodurch du sie an einen Verstärker oder ein Mischpult anschließen kannst, sowie einem Power-Eingang. Einstellen kannst du verschiedene Tonhöhen, wobei sie sich in dieser Hinsicht von der Classic nicht wirklich unterscheidet. Die Deluxe ist schlichtweg größer. Wenn deine Sneakers in Größe 48 trägst, trampelst du dieser Logik zufolge auf Sneaker-Deluxe durch den Alltag.


Otamatone Techno
Der Unterschied der Otamatone Techno zur Classic ist insbesondere die Möglichkeit, das Instrument mit dem Smartphone bzw. iPhone oder sonstigen mobilen Endgeräte zu verbinden und somit auf die Features der App zurückzugreifen, wodurch die Spielmöglichkeiten und erst recht die Sounds und Effekte deutlich erweitert werden. Ebenso kannst du verschiedene Tunings nutzen. Das Prinzip von Tonerzeugung und Spieltechnik bleibt identisch, allerdings mit deutlich erweiterter Klangausbeute.
Otamatone Neo
Die Neo ist eine Otamatone Classic mit extra Funktionen und zugleich das aktuell neueste Modell. Das Neo gehört zu den preisgünstigeren Modellen und bietet dabei vollen Funktionsumfang inklusive der verstellbaren Töne via der Studio Handy App., Verlinkung mit Handy per Kabel etc. In Sachen Spieltechnik unterscheidet das Modell sich nicht von seinen Familienmitgliedern. Die Bedienung durch Drücken auf der Klangfläche am Hals sowie dem Öffnen und Schließen des Mundes.


Otamatone Wahha Gogo
Die Otamatone Wahha Gogo unterscheide sich in technischer Hinsicht nicht vom Original. Vielmehr handelt es sich um eine weitere Designstudie, wobei Zähne für den besonderen Aha-Effekt sorgen. Wenn du auf trendiges Outfit mit einem Hauch von Gruselfaktor stehst, könnte die Wahha Gogo deine ideale Wahl sein, wenn du eine Otamatone kaufen möchtest.
Otamatone Digital
Ein spezielles Instrument aus der Familie ist das Otamatone Digital. Die Besonderheit ist, dass die Grifffläche durch ein kleines Piano-Keyboard ersetzt wird. Damit nicht genug. Dieses Modell ermöglicht dir auch, komplette Akkorde zu spielen. Schade eigentlich, dass es sich bislang nicht wirklich durchsetzen konnte. Offensichtlich bevorzugen die Musiker dieses Spaß-Instrument in der Mono-Version.
Otamatone Jumbo
Wie der Name leicht vermuten lässt, handelt es sich bei der Jumbo um das größte Modell. Das Synthie-Instrument besitzt immerhin solche Dimensionen, dass du es eher seitlich halten musst, wenn du Otamatone spielen möchtest. Zudem drückst du den Kopf nicht lediglich mit den Fingern zusammen. Vielmehr ist eine separate Klemme enthalten, um den Mund damit zu drücken. Dieses Modell wirst du im Handel kaum finden. Falls doch, greif zu! Zum Einsatz gekommen ist diese Version fast ausschließlich auf Messepräsentationen und Promotion-Events.

Besonders interessant wird es mit der Studio-App
Längst wird vom Hersteller auch eine App angeboten, die insbesondere die Modelle Otamatone Techno, Otamatone Neo und Otamatone Digital unterstützt. Mit der App stehen dir zunächst weitere Sounds zur Verfügung. In der kostenlosen Version beschränkt sich das auf Otamatone, E-Gitarre und Alt-Saxofon. Die kostenpflichtige Vollversion bietet zusätzlich Violine, Flöte, Synthie-Trompete und sogar eine Drum-Sektion. Die Voices kannst du einfach über das Display deines Smartphones auswählen.
Authentischer Instrumentenklang schreibt sich anders
Ebenso in der App integriert sind verschiedene Effekte, so etwa Reverb und Delay, mit denen du für den angenehmen Raumklang sorgst, außerdem der Distortion-Effekt, mit dem die Sounds einer verzerrten elektrischen Gitarre imitiert werden. Und dann gibt’s auch noch den katzenartigen Sound. Wenn du eine Otamatone kaufen und die Studio-App nutzen möchtest, solltest du die Erwartungen an die verfügbaren Stimmen nicht zu hoch ansetzen.
Die Voices sind deutlich verändert, haben aber mit den echten Instrumenten wenig zu tun. Die Japaner sind überaus freundliche und nicht minder intelligente Menschen. Aber was die findigen Asiaten unter dem authentischen Klang einer Trompete verstehen, erschließt sich einem westeuropäischen Gehör nicht wirklich. Und der Katzenklang klingt auch nicht gerade fürsorglich gestreichelt. Aber sei’s drum; wir hatten vereinbart, uns vom Schubkastendenken zu verabschieden.
Unterschiedliche Tonarten und Tonbelegungen einstellbar
Einstellen lassen sich unterschiedliche Tonarten bzw. Tonleitern. Die Auswahl erstreckt sich über die 12-Tonleiter über den Moll-Blues, Dur, Moll, Dur-Blues, die Ganztonleiter, Pentatonik oder die typische japanische Tonleiter. Ach ja, die Otamatone-Tonleiter nicht zu vergessen. Auch hier sind wir freudig beeindruckt. Immerhin hat ein Spielzeughersteller mal eben eine neue Tonleiter definiert.
Diverse Rhythmen mit zusätzlichen Kuriositäten an Bord
Damit aber längst noch nicht genug. Über die App kannst du zudem auf unterschiedlichste Rhythmen zugreifen. Auch hier unterscheidet sich das Angebot zwischen kostenloser und Vollversion. Erstere bietet dir die Rhythmen Rock01, Techno01, und Japan (was auch immer das zu bedeuten hat). Erweitert wird das Spektrum in der Full Version durch Rock02, Samba, Salsa, Marsch, India und – Achtung es wird ein wenig irre – „Happy Birthday“.
Lerne und staune: Bei Happy Birthday soll es sich also um einen eigenen Rhythmus handeln. Andere Kultur, anderes Musikverständnis. Auf alle Fälle herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, auf den Tag genau, nachträglich, vorzeitig, außerplanmäßig oder wann auch immer.

Spaßbringer und musikalischer Experimentierbaukasten
Dich zu entscheiden, ob es sich hier um musikalisches Spielzeug oder ein spaßbringend ernstzunehmendes Instrument handelt, ist schlichtweg nicht nötig. Zugegeben, wenn du eine Otamatone kaufen möchtest, wirst du teils verwunderte Blicke ernten. Aber exakt ist es doch, was uns Musiker umtreibt: Die Aufmerksamkeit durch das Ungewöhnliche. Die musikalische Kaulquappe hat eindeutig das Potenzial, Ohren und Augen der Zuhörer auf sich zu ziehen.
Praxis: Otamatone spielen ohne Schubkastendenken
Ernstzunehmendes Musikinstrument oder Spielzeug? Die Frage stellt sich allenfalls für diejenigen, die für das eigene Wohlbefinden fest bürokratisierte Kategorien benötigen. Manche Instrumente passen nun mal nicht in einsame Schubladen; wenigsten nicht in eine einzige. Die Otamatone wird zwar als singendes Spielzeug bezeichnet. Tatsächlich aber handelt es sich um einen rudimentären Synthesizer im Spielzeugformat, mit dem sich einige sehr spezielle Effekte umsetzen lassen. Sehen wir genauer hin, was und wie man auf einer Otamatone spielen kann:
Otamatone kaufen: Vertonter Unfug oder visionär?
Mag sein, dass die Otamatone aufgrund ihrer Herkunft in die Spielzeugecke gedrängt wird. Immerhin wurde sie von einem japanischen Spielzeughersteller erfunden, nämlich der Firma CUBE im Jahr 1998. Verantwortlich für das spezielle Design war die ebenfalls aus Japan stammende Firma Maywa Denki. Die Manga-verliebten Asiaten hatten sich damit an den Anforderungen von Kids orientiert und ernsthafte Musiker im selben Zug gewissermaßen vor den Kopf gestoßen. Dabei war die Idee geradezu genial, weil absolut auf den Punkt gebracht.
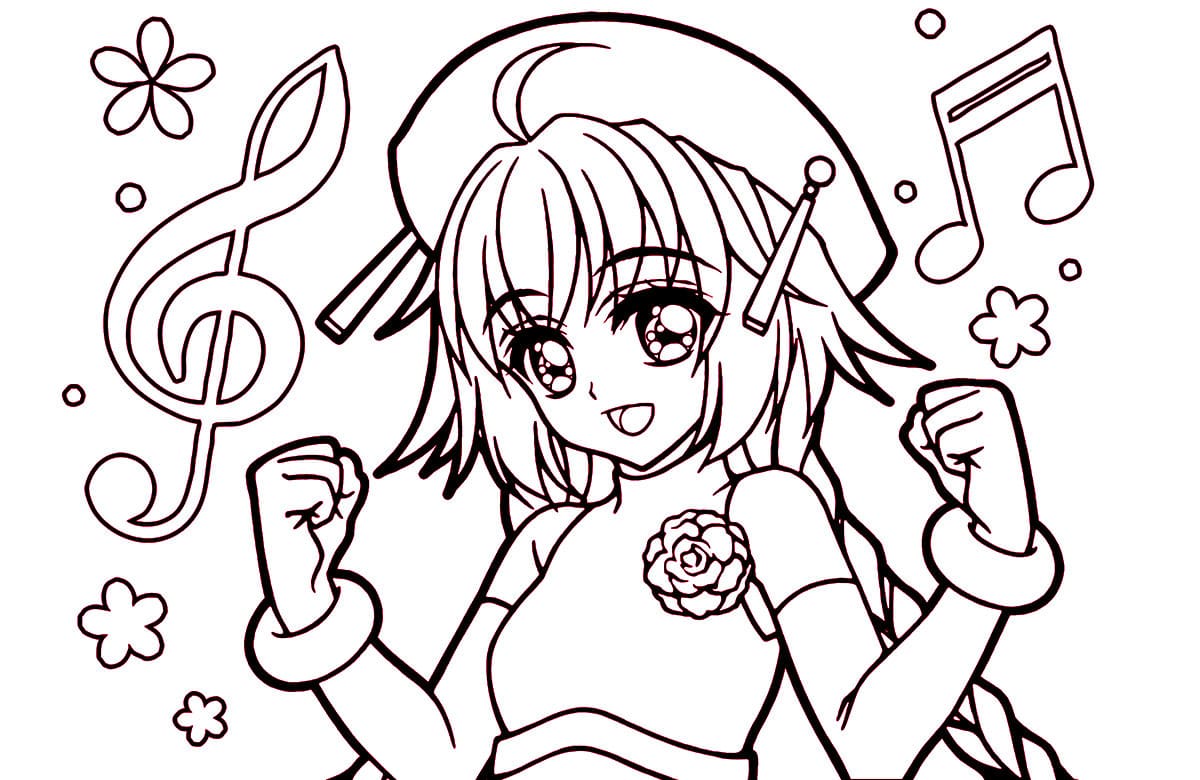
Kurioses Design im Format einer Mega-Achtelnote
Designt ist die Otamatone in Form eine Achtelnote, also mit Bauch, Hals und der berüchtigten Fahne. Typisch gibt es das Instrument in unterschiedlichen, teils schrillen Farben, außerdem mit Designs, die an Manga & Co. erinnern. Wie bei einem Keyboard handelt es sich eben nicht um ein Naturinstrument. Stattdessen bestehen die äußeren Komponenten aus Kunststoff, der Hals und die Fahne aus Plastik, der Bauch dehnbarem und zugleich nicht zu weichem Gummi. Eines ist klar: Optisch ist das Otamatone ein Hingucker mit Fun-Faktor. Der Run hatte begonnen, Massen von Manga-Fans wollten eine Otamatone kaufen.

Der Versuch einer Klangbeschreibung
Synthetische Klänge mit Worten zu beschreiben, ist ohnehin nicht ganz simpel. Klang muss man hören, erst dann wird die musikalische Vorstellungskraft wirklich beflügelt. Im allwissenden Web ist als Klangbeschreibung immer wieder zu lesen, die Otamatone sei vergleichbar mit einem Theremin, einem Synthesizer und sogar der menschlichen Gesangsstimme verglichen. Das ist vermutlich ziemlich hoch bzw. am falschen Kleiderhaken aufgehängt. Die Aussage ist ein verkehrt verstandenes Werbestatement. Am Reiz des Instrumentes ändert das nichts. Der Klang ist eigenständig, leicht quäkend, identifizierbar und durchsetzungsfähig.
Auf alle Fälle ungewöhnlich
Wenn du Otamatone spielen möchtest, lässt du dich damit auf ein interessantes Abenteuer ein. Immerhin ist die Klangerzeugung recht ungewöhnlich. Immer wieder wird versucht, Vergleiche mit anderen Instrumenten anzustellen. Die sind aber meistens nicht möglich und zweitens irreführend. Die Klangerzeugung erfolgt durch Druck mit einem Finger auf die Sensoroberfläche auf der vorderen Seite des Halses. Ausgegeben wird der Klang über den Kopf, der sich wiederum individuell beeinflussen lässt. Möchtest du eine Otamatone kaufen, bedeutet das auch, sich von Konventioenen zu verabschieden.
Otamatone kaufen und spielbereit machen
Bevor du auf der Otamatone spielen kannst, musst du sie zunächst einsatzbereit herausputzen. Das ist allerdings nicht das geringste Problem, stattdessen vollkommen simpel. Letztlich beschränkt sich die Vorbereitung darauf, die AAA-Batterien einzusetzen. Anschließend stellst du am Volumenregler die gewünschte Lautstärke ein und wählst schlussendlich am Oktavenregler das jeweilige Level niedrig, mittel oder hoch.

Und schon geht’s los – die ersten Töne per Fingerdruck
Um Töne auf der Otamatone zu erzeugen, drückst du an beliebiger Stelle auf die vordere Seite des Halses, auf der sich die Klangfläche befindet. Bedenken musst du dabei, dass auf dem Griffbrett keinerlei Bünde wie etwa bei einer Gitarre vorhanden sind, an denen du dich in Sachen Tonhöhe orientieren kannst. Theoretisch kannst du die Griffposition für die jeweiligen Einzeltöne mit einem Marker auf der Grifffläche anzeichnen. Du könntest ein digitales Stimmgerät zu Hilfe nehmen, die Töne bestimmen und darauf basierend die Markierungen setzen. Allerdings bleibt es bei der Theorie.

Bünde markieren allenfalls eingeschränkt möglich
Die positive Option, die Tonhöhe bzw. Oktaven zu verstellen, erweist sich für solche hilfreichen Markierungen als Problem. Sobald du über den Wahlschalter eine andere Tonhöhe wählst, stimmen die Abstände der Markierungen und somit die Töne nicht mehr. Wollten wir die gemalte Bundierung auf die Spitze treiben, müsstest du für alle drei Tonhöhen in unterschiedlichen Farben Markierungen setzen. Das Resultat wäre die gelebte Unübersichtlichkeit schlechthin.
Umso verwirrender, bei Wahl verschiedener Tonleitern
Und die Problematik wäre noch nicht mal überwunden. Immerhin kannst du bei den Modellen wie der Otamatone Neo oder Otamatone Techno auch zwischen verschiedenen Tonleitern wählen. Und dann hat auch die letzte Markierung sich selbst den Garaus gemacht. Noch weniger als zuvor werden die Abstände der Töne stimmen, zumal die Differenzen exakt definiert werden müssen. Konzipiert sind die Tonabstände wie bei einem Gitarrenhals. Von den tiefen zu den hohen Tönen werden die Abstände kleiner. Exakt diese Tatsache steht der tonartübergreifenden Markierung im Wege.
Die Problematik der sauberen Intonation
Aber du bist höchst ambitioniert und weißt genau, dass es kein Instrument ohne jeweils spezielle Herausforderungen gibt. Wie jeder Violinist wirst du dir die korrekte Lage der Töne schrittweise und mit Übungsfleiß erarbeiten. Wichtig ist das dafür, damit die Melodien wenigstens einigermaßen sauber intoniert klingen. Wenn du Otamatone spielen möchtest, brauchst du ein gut ausgebildetes Gehör. Aber keine Furcht vor Unlösbarem. Kontrolliere dich immer wieder selbst. Kontinuierlich wirst du besser und treffsicherer werden.
Die virtuelle Menschlichkeit über den Mund des Instrumentes
Besonders facettenreih klingt der Ton durch Öffnen und Schließen des Mundes. Und nein, die Rede ist nicht von deinem Mund, sondern von dem des Instrumentes, der sich am Bauch befindet. Vorstellen könntest du dir daraus resultierenden Sound wie bei einem Dämpfer auf der Trompete. Erst recht, weil das Instrument hinsichtlich seines Designs vermenschlicht ist, werden Erinnerungen an eine singende oder jaulende Bauchrednerpuppe wach.

Mit Wah-Wah-Effekt vermenschlichte Töne
Lediglich eine der Besonderheiten, allerdings eine durchaus entscheidende, ist der Wah-Wah-Effekt, den du durch variablen Druck auf den „Kopf“ der Otamatone erreichst, wobei der „Mund“ des Instrumentes eben mehr oder weniger geschlossen wird. Gerade über diesen Effekt bekommen die Töne einen stimmähnlichen Charakter. Unkompliziert kannst du diese Tonerzeugung an dir selbst ausprobieren. Wenn du einen dauerhaften Ton singst und währenddessen die Lippen abwechselnd weiter öffnest und wieder zusammenziehst, geschieht genau der gleiche Effekt. Nur willst du nicht singen, sondern Otamatone spielen. Wie gesagt, der vermenschlichte Effekt ist identisch.
Unterbrechungsfreier Tonwechsel mit Portamento
Durch weitere Spieltechniken lassen sich die Melodien auf der Otamatone besonders organisch und abwechslungsreich gestalten. Widmen wir uns zunächst dem Portamento. Tolle Wurst, woher sollst du als Einsteiger wissen, was Portamento bedeutet. Ruhig Blut, hier kommt auch schon die Erklärung: Mit Portamento bezeichnet man den unterbrechungsfreien Wechsel zwischen zwei Tönen. Plakativ ausgedrückt: Nachdem du einen Ton gegriffen hast, gleitest du – ohne den Finger hochzuheben – zum nächsten Ton und wieder zurück. Wenn du eine Otamatone kaufen und spielen möchtest, beschäftigst du dich sogar mit Musiktheorie, wer hätte das gedacht?
Otamatone ist das geborene Legato-Instrument
Das gleiche Prinzip gilt für Legato-Noten, für gebundene Noten, für die eben nicht separat abgesetzt wird. Das Otamatone ist für diese Spielweise geradezu prädestiniert. Während bei anderen Instrumenten wie beispielsweise der Gitarre nur der erste Ton angeschlagen und dann zum nächsten Ton gerutscht wird, bei einer Violine bei einem Bogenstrich die Greifhand von einem Ton zum nächsten Ton gleitet, ist das beim Otamatone noch eine Portion simpler. Immerhin wird kein Ton angeschlagen, sondern lediglich per Finger gedrückt. Wenn du solche Töne auf der Otamatone spielen möchtest, hältst du den Druck des Fingers einfach aufrecht und gleitest zugleich zum nächsten – gebundenen – Ton. Keinesfalls übertrieben ist die Behauptung, die Otamatone sei das geborene Legato-Instrument. Captain Kirk lässt grüßen.
Vibrato: Mit sämtlichen Frequenzen fest in der Luft
Und so hält das Instrument weitere Ausdrucksmöglichkeiten für dich bereit, beispielsweise das Vibrato. Schon wieder ein erklärungswürdiger musikalischer Fachbegriff. Dürfen wir es kompliziert machen? Vibrato ist in der Musik die periodisch wiederkehrende geringfüge Veränderung der Frequenz eines gehaltenen Tons. Irre, das muss auch verständlicher auf den Punkt zu bringen sein. Okay, nächster Versuch. Wenn du einen gespielten Ton ganz leicht und mehrfach nach oben oder unten veränderst und jeweils in die Ausgangsposition zurückkehrst, entsteht ein schwebender Ton. Exakt das versteht man unter Vibrato. Aber wie funktioniert, wenn du Vibrato auf dem Otamatone spielen möchtest?
Den zitternden Wendehalt nicht übertreiben
Entgegen kommt dir dabei die Tatsache, dass der Hals leicht beweglich ist. Indes du einen Ton spielst oder bereits gespielt hast und ihn weiterklingen lässt, bewegst du zeitgleich den Hals des Instrumentes hin und her. Bitte nicht zu stark, schließlich möchtest du lediglich den Ton modulieren und nicht gleich den Hals abbrechen. Und überhaupt solltest den Einsatz von Vibrato als Effekt nicht übertreiben, ihn stattdessen auf lange Töne beschränken wie die letzten Töne einer Phrase oder Passage. Effizient eingesetztes Vibrato macht die Töne lebendig, ausdrucksstark und expressiv. Überzogenes Vibrato hingegen sorgt eher dafür, dass das ganze Stück wehleidig vor sich hin jammert. Das war vermutlich nicht dein Ziel.






+++
Auch interessant: „Workshop: Wie funktioniert ein Synthesizer?“





