
Selbstverständlich kann man auch falsch üben, aber nicht in einem einfachen Verständnis. Denn es kann im Sinne der Richtigkeit höchst nützlich sein, Fehler zu machen. Es gibt Fehler, die Umwege sind – und Umwege erhöhen bekanntlich die Orientierung. Und es gibt Fehler, die zu Erstarrung und Reduktion führen können. Diese Ebenen zu unterscheiden, bildete das Thema eines praxisorientierten Workshops mit der Pianistin Ana-Marija Markovina, der von der Landesmusikakademie NRW im April 2025 durchgeführt wurde. Einen weiteren Aspekt stellte dabei die Dimension des effektiven Übens im Hinblick auf ein nützliches Zeitmanagement und Strategien zum zeitsparenden Klavierüben dar.
Check it: Richtig üben am Musikinstrument
- Beim Instrumentenspielen können einem unterschiedliche Fehler unterlaufen
- Je nach Ursache behandelt man sie auch unterschiedlich
- Am Anfang langsam üben, Tempo kann später kommen
- Ein Stück in kleinere Passagen unterteilen, anstatt immer wieder von vorne zu beginnen
- Man kann nicht „falsch“ üben, nur ineffektiv
Ana-Marija Markovina war bestens auf ihren Workshop zum Thema „Richtig Üben“ vorbereitet. Kein Wunder, blickt die promovierte Musikerin doch auf eine langjährige Erfahrung als erfolgreiche Konzertpianistin und leidenschaftliche Musikpädagogin zurück. Kurz zur Person: Frau Markovina (Jahrgang 1970) stammt aus Kroatien. Nach ihrer Schulzeit studierte sie Klavier an den Musikhochschulen Berlin, Wien und Weimar. Als Solistin spielte sie mit zahlreichen deutschen und internationalen Orchestern zusammen. Ihre Diskographie zählt mittlerweile über 40 Aufnahmen, darunter Ersteinspielungen der Werke von Hugo Wolf, Luise Adolpha Le Beau, Anton Bruckner und Felix Mendelssohn. Für ihre Aufnahme des gesamten Klavierwerks von Carl Philipp Emanuel Bach erhielt sie den Preis der Deutschen Schallplattenkritik sowie eine Grammy-Nominierung.
Seit über 25 Jahren ist Frau Markovina zudem als überaus engagierte Pädagogin tätig. So war sie häufig Jurymitglied bei Nachwuchswettbewerben, Veranstalterin von Klaviermeisterkursen und Workshops sowie Referentin bei Vortragsreihen zum Themenkreis „Musik und Psychologie“. 2019 erschien ihre erste Publikation „GLÜCKS-Spiel“. Darin beschreibt sie anhand von Fakten aus Musikwissenschaft, Philosophie und (Neuro-) Psychologie den Zusammenhang zwischen persönlichem Glücksempfinden und Musizieren. Sie ist sich sicher: Glück ist nicht purer Zufall, sondern das Ergebnis klugen Gestaltens. Auf dieser Grundlage baute auch ihr Workshop zum Thema „Richtig Üben“ auf.

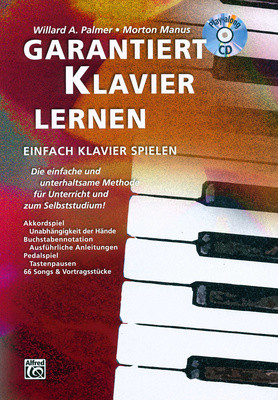
Sind Fehler unsere Feinde oder Verbündeten?
Der Workshop startete mit einer kurzen Reflexion darüber, was eigentlich ein Fehler ist. Ein vielleicht im ersten Moment paradox klingender Leitspruch von Frau Markovina lautete: „Zu Hause beim Üben sind Fehler absolut tabu, aber im Konzert spielen sie gar keine Rolle.“ Das mag verwirren, denn man könnte meinen, dass es eigentlich genau umgekehrt ist. Ein Fehler, so Markovina, ist eine nicht angemessene Reaktion oder Einschätzung von Gegebenheiten, Verläufen bzw. Umgangsformen mit anderen Menschen und Situationen. Dabei unterschiedet man zwischen Handlungsfehlern, Einschätzungsfehlern und Bewertungsfehlern, wobei die Fehler beim Instrumentalspiel der Kategorie der Handlungsfehler zugerechnet werden. In der Musik habe der Fehler viele Gesichter: falsche Töne oder Noten, falsche Rhythmen, Tempi, Dynamik, Artikulation oder Pedalisierung. Wahrnehmungspsychologisch liege ein besonderes Gewicht auf den nicht korrekten Noten.

Hieraus ergab sich für Frau Markovina die interessante Frage, ob Fehler als unsere Feinde betrachtet werden müssen. Oder sind sie möglicherweise eher als unsere Verbündeten zu verstehen? Ihre Antwort: „Wie ein Schmerz im Körper einen Hinweis darauf gibt, was nicht in Ordnung ist, zeigt uns ein Fehler das an, was nicht klar und was nicht vertraut ist. Fehler gleichen Detektoren. Sie helfen uns, zu verstehen. Das ist im Leben so wie in der Musik.“

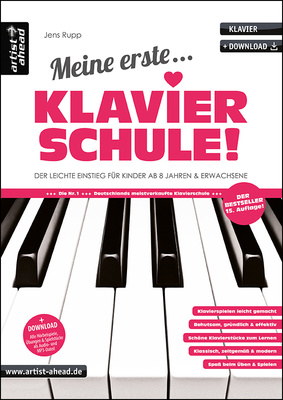
Bevor Fehler aber zu wahren Helfern werden, gibt es eine Phase, in der sie erst einmal vermieden werden sollten, so Frau Markovina: „Nämlich dann, wenn wir ein neues Stück lernen. Ich spreche hier erst einmal vom Üben: Beim Üben soll man nach Möglichkeit keine Fehler zulassen, einfach weil sie mit ‚abgespeichert‘ werden. Ich plädiere daher für langsames, bewusstes Lesen des Notentexts, um dann das Tempo nur in dem Maße zu steigern, dass die Fehlerfrequenz nicht zunimmt. Nun ist selten ein Schüler bereit, Passagen oder Stücke lange Zeit langsam und richtig zu spielen, bis es wirklich verinnerlicht ist und man sich sicher fühlt, die Fehlerfreiheit also von allein und wie selbstverständlich kommt. Dazu braucht man Geduld.“
Zum Thema Fehler gehört für die Pianistin Markovina vor allem die Dimension der Aufmerksamkeit: „Ich benutze im Unterricht folgendes Bild zur Veranschaulichung des richtigen Übens: Stellen Sie sich einen Punkt vor, der immer wieder angemalt wird und dadurch immer dicker, immer prägnanter wird. Und jetzt stellen Sie sich einen Punkt vor, der neben sich ganz viele gleich große Punkte hat, weil man immer danebentrifft. Es entsteht eine Art Nebel. Dieser Nebel ist auch in unserem motorischen Kortex repräsentiert und lässt die Treffwahrscheinlichkeit in der Aufführung verschwinden. Wenn wir immer die richtige Tonfolge treffen, dann erhöht sich die Prägnanz der Gestalt. Die Punkte werden größer und deutlicher. Wenn man immer daneben spielt, dann entsteht dieser Nebel. Ich schlage also vor, dass man länger langsam und richtig spielt, statt früh schnell und als Konsequenz unsauber.
Wenn man ein Stück schon halbwegs kann, tritt ein neues Phänomen auf: man verspielt sich wieder, aber das ist ein anderes Verspielen als in der Textlernphase. Wenn also ein falscher Ton vorkommt, dann ist das nicht schlimm, im Gegenteil: Es ist gut! Denn nur so merken wir, dass wir den Text (oder auch später beim schnellen Spiel die Bewegung) nicht richtig integriert haben.

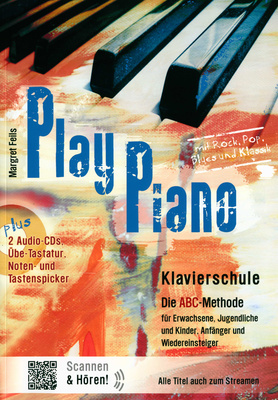
Bei der Vorbereitung auf ein Konzert, oder bei meinen Schülerinnen und Schülern, die sich auf einen Wettbewerb vorbereiten, merke ich oft nicht mehr, welche Stellen nicht ganz präsent sind. Das ist die Phase, wenn ein Stück schon sehr im eigenen System ist und man es sicher beherrscht. Dann fehlt uns aber immer noch oft das höhere Level des Wissens. Man kann selbstverständlich mental üben, das ist sehr wichtig. Aber eine Stufe darunter könnte ich vorschlagen, einige Experimente zu machen, wie etwa das Stück in Zuständen großer Müdigkeit durchzuspielen oder ‚auf Risiko‘, also besonders schnell, besonders laut, etwas über die Grenze des Kontrollierbaren hinaus zu spielen, um festzustellen, welche Stellen noch nicht belastbar sind. Dann passieren Fehler oder Gedächtnislücken oder musikalisch unlogische Übergänge, an denen man arbeiten kann. Man kann das selbst mal ausprobieren oder auch ein Experiment im Unterricht wagen – so circa drei Wochen vor einem Wettbewerb oder Vorspiel. Das ist eine ganz andere Phase als die Textlernphase. Und hier sind Fehler vor allem eines: Hinweise darauf, was noch zu arbeiten ist.“
Fehler dulden und verstehen
Hierauf aufbauend wurde im Weiteren die Frage behandelt, wie man denn nun mit Fehlern sinnvoll umgehen kann. Bei der Beantwortung waren Frau Markovina folgende Schlüsselbegriffe wichtig: „Wir dulden Fehler nicht, aber wir verurteilen sie auch nicht. Wir versuchen, sie zu verstehen. Wir interpretieren die Hinweise, die Fehler uns geben, ohne zu werten. Fehler sind nicht schön zu hören, sie stören durchaus und gehören eigentlich nicht zur Musik. Der Komponist und Pianist Franz Liszt nannte falsche Töne ‚ungebetene Gäste‘. Aber: Man kann sie nicht ausmerzen, man kann sie nur verringern.“

Für Frau Markovina existiere eine schöne Regel: „Beim Üben sind Fehler unpraktisch, wir suchen nach Wegen, damit sie nicht stattfinden – oder wenn sie stattfinden, sie als Hinweis zu interpretieren. Im Konzert sind sie vielleicht nicht erwünscht, aber sie sind kein Grund zum Verzweifeln. Überhaupt nicht. Fehler passieren jedem und sie passieren sowieso. Aber wenn wir sie beim Üben belassen, dann passieren sie nicht einfach, sondern sie sind gleichsam programmiert. Hieraus kann die erste Schlussfolgerung gezogen werden: Ja, man hat falsch geübt, wenn man immer wieder über Unsauberkeiten und falsche Töne, über holprige Stellen, Nachgreifen und Zögern, über Verhaspler und Streiftöne hinwegspielt. Man hat sie dann sozusagen mitgeübt und folglich einprogrammiert. Man hat hingegen richtig geübt, wenn im Vortrag das eine oder andere passieren darf, ohne dass die interpretatorische Gesamtgestalt darunter leidet. Andererseits ist es so, dass Fehler helfen können, ein Stück ernsthaft zu verbessern. Fehler zeigen uns Pfade auf dem Weg zum Wissen. Fehler zeigen uns die verschiedenen Wege – genauer: die Umwege. Und Umwege erhöhen bekanntlich die Ortskenntnis.“

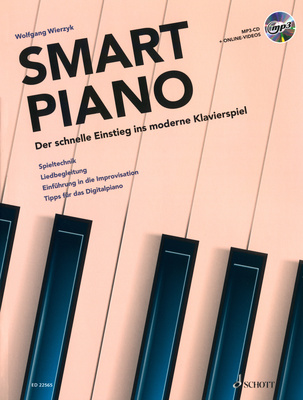
Langsam Üben
Eine weitere sinnvolle Methodik in diesem Zusammenhang betrifft das langsame Üben. Laut Frau Markovina kommt es hierbei vor allem auf eine Dimension an: nämlich Geduld. Was passiert beim langsamen Üben und warum ist das eine „Abkürzung“?
„Man muss sich das motorische Feld so vorstellen, wie als ob man sich einen Trampelpfad in den Urwald schlage“, antwortete Markovina. Denn in Bezug auf die benötigten neuronalen Felder herrsche vor der Übephase urwaldmäßige Unwegsamkeit. Je öfter man hier entlanggeht, desto fester/markanter werden allmählich der Untergrund und die Wegbegrenzungen.
Aber warum sollte dies langsam geschehen?
Hier kommt die Dimension der Aufmerksamkeit hinzu. Wie bereits erwähnt, sind Fehler beim Üben nicht von Vorteil, zumindest nicht, wenn man ein Stück neu einstudiert. Das langsame Üben hilft dabei
– zu verstehen, was wir da eigentlich spielen
– die Bewusstheit der motorischen Abläufe zu schärfen (man denke an Fingersätze)
– wahrzunehmen, welche Klänge und harmonischen Zusammensetzungen überhaupt vorkommen.
„Die Geduld“, führte Frau Markovina weiter aus, „ist wichtig, damit wir diesen Werdungsprozess nicht abkürzen und die gerade entstehenden neuronalen Felder durch unkontrolliertes Durchspielen behindern. Die Bedingungen hierfür liegen in den kognitiven und motorischen Zentren des Gehirns. Kognitive Lernprozesse sind nicht beliebig zu beschleunigen. Das erkennen wir spätestens dann, wenn wir versuchen, eine Sprache zu lernen. Auch die motorische Sicherheit einer neu zu erlernenden Bewegung darf nicht im Tempo der schließlich vollkommenen Bewegung als Lernprozess von statten gehen. Wer mit der Sicherheit eines Seiltänzers als Anfänger auf das Seil geht, fällt runter.
Und ich betone es hier noch einmal, was ich in meinem Buch ‚GLÜCKS-Spiel‘ ausführlich geschildert habe: je weniger Zeit ich zum Üben habe, desto langsamer übe ich. Das ist vor allem so, wenn ich in kurzer Zeit ein schwieriges, anspruchsvolles neues Stück einstudieren muss.

Natürlich verbleibt man nicht bei dieser Methodik. Wir werden nicht auf unbestimmte und nicht absehbare Zeit immerwährend langsam üben. Das wäre schlicht unkünstlerisch. Und auch langweilig! Aber wir legen damit das Fundament der Interpretation. Und das gibt uns für alle weiteren Schritte enorme Sicherheit. Auch hat dieses langsame Üben nichts mit der endgültigen Interpretation zu tun – jedenfalls nicht direkt. Denn man kann auch später noch ein langsames Tempo wählen, das ist trotzdem auf demselben Fundament. Und das interpretatorisch langsame Tempo verlangt das gleiche Fundament wie ein schnell gewähltes Tempo. Es ist ja nicht so, dass wir schnell besser spielen, nur weil wir die Langsam-Spiel-Phase überspringen haben. Deutlicher: Beim Überspringen der langsamen Phase sind Fundamente nicht gelegt worden, die nachher für das schnelle Spiel unerlässlich sind.“

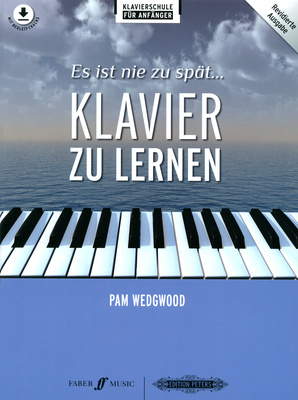
Leise Üben
Ein weiterer Themenaspekt wurde im Folgenden mit dem Phänomen des leisen Übens angesprochen: „Wir steigern das Tempo, irgendwann, wenn wir sicher genug sind. Und dann passiert häufig folgender Fehler: man spielt zu früh zu laut. Wieder hat die Hand keine Gelegenheit, sich dem Text, der Struktur des Stückes anzupassen. Zum richtigen Üben gehört also sauber, langsam und leise zu üben. Es ist ein direkter Weg zum Wohlbefinden am Klavier. Das alles gilt nach wie vor erst einmal für eine Lernphase. Aber ab dann kommen ganz neue Freiheiten zum Tragen. Ist das Fundament erst einmal solide gelegt, kann man sich den ganz persönlichen Weg suchen, egal wie unkonventionell. Ab hier wird es immer individueller.“
Abschnitte üben
Der vorletzte Hinweis, den Frau Markovina ausführte, kreiste um das Thema: In kleinen Abschnitten üben. „Divide et impera – teile und herrsche“, laute hier die Devise. „Bitte nicht das Stück immer wieder durchspielen“, empfahl Markovina, „zumindest nicht im Lernstadium. Später muss man das Durchspielen trainieren, aber das ist eine andere Frage. Es geht darum, ein Stück in kleinen Abschnitten zu erobern. Konkret: man könnte das Stück kopieren, die Takte oder Passagen herausschneiden und auf ein extra Blatt kleben. Das sind die Portionen, die zu üben sind. Der Vorteil ist, dass man bei diesen Schnipseln alle Parameter berücksichtigen kann, die dastehen, also auch dynamische Angaben, Artikulation etc.
Wenn man schon einigermaßen spielen kann, die Interpretation aber immer noch unsauber ist, dann wäre mein Vorschlag folgender: Kleine Passagen so lange mit dem Handy aufzunehmen, bis sie sauber sind und bis man die schöne Gestalt erkennen kann. Das saubere Spiel ist ja in der Gestalt prägnanter. Wenn Sie einen einzigen Takt wirklich sauber dargeboten haben, wirkt sich das auch auf den nächsten Takt aus, ohne dass man ihn extra übt. Ich habe da einen Trick: Ich lasse immer den übernächsten Takt üben, der Zwischentakt wächst dann automatisch mit. Es ist also ein Puzzle-Spiel. Das verstehen die Schülerinnen und Schüler und haben großen Spaß daran, die Teile zusammen zu setzen. Überhaupt ist das Puzzeln ein wichtiger Aspekt des richtigen Übens und auch des schnelleren Lernens.“


Weitere Tricks
– Rückwärts lernen, von hinten anfangen. Das hat die Vorteile, dass man viel mehr Einstiegsstellen hat und dass man dem Vertrauten entgegen spielt.
– Hände einzeln mit Metronom üben. Das schafft eine große Stabilität sowohl im Rhythmus als auch in den Bewegungsabläufen der jeweiligen Hand.
– Wochenpläne erstellen und Bilanzen ziehen. Dann spielt es keine Rolle, wenn man an einem Tag mal weniger Zeit hatte. Das Defizit kann dann leicht nachgeholt werden – es zählt die Schlussbilanz.

„Auch wenn man das alles nicht beachtet“, so bilanzierte Markovina, „und einfach nur ‚frei nach Schnauze‘ übt – glauben Sie mir, Sie werden besser, als wenn Sie gar nicht üben. Nicht jeder hat den Zugang zu den wichtigen Informationen, nicht jeder hat gelernt, wie man effektiv üben kann. Und trotzdem geht es vorwärts. Der Grund dafür ist unsere innere Kraft, die zur Gestaltschließung strebt. Wir wollen es können, wir wollen es spielen, wir wollen gestalten! Und dann folgen die Finger, der Körper manchmal mehr schlecht als recht, aber sie folgen. Man wird tatsächlich besser. Man kann also nicht wirklich falsch üben, aber – und das ist entscheidend – man kann ineffektiv üben.“
