
Es sieht abenteuerlich aus, wie die 32 Kinder und Jugendlichen ihre Querflöten senkrecht auf dem Kopf platzieren. Ein bisschen wirken sie dabei wie lebende Marionetten, die ihren Kopffaden als Antennen einsetzen. Die kleinsten Querflötenspieler sind fünf Jahre alt, die älteren bereits in der Pubertät. Von allen aber fordert das gut durchchoreographierte „Warming up“, das Britta Roscher mit ihnen in der Limburger Jugendherberge auf Englisch durchführt, allergrößte Disziplin. Schließlich soll keines der kostbaren Instrumente herunterfallen, die sie auf ihren Köpfen balancieren.
Mit einem schmissigen Mambo, den Harry Bellafonte aus dem Recorder schmettert, geht das eindeutig leichter: „Jump in the line, rock your body in time.“ Spielerisch auch die vielen Muskelübungen für den Mund: Das stimmlose „SSSSS“ wie in „Snake“ zischen sie gemeinsam, auch das leisere „SCH“, das an ein Sprechverbot erinnert. Und können diejenigen, die ein C im Vornamen haben, schon das C auf der Querflöte spielen? Na klar: Mehrere Arme gehen nach oben, dann blasen die Kandidaten gemeinsam das C.
Check it: Die Suzuki-Methode
- Bei der Suzuki-Methode lernt man nach Gehör, nicht nach Noten
- Entwickelt wurde die Methode von dem japanischen Geiger Shinichi Suzuki
- Inzwischen gibt es die Methode für 15 Musikinstrumente
- Renommierte Musiker wie die Geigerin Julia Fischer haben nach der Suzuki-Methode gelernt
- Es geht um Nachahmen, Bewegung und Freude am Spiel
Suzuki: Bessere Menschen, nicht Spitzenmusiker um jeden Preis
Querflötistin Britta Roscher, Mitglied des Wiesbadener „Musiklehrernetzwerks 2.0“, ist in Hessen eine der deutschlandweiten Pionierinnen, was die Suzuki-Methode betrifft. „Außer mir sind wir nur etwa 20 bis 25 Flötenlehrer in ganz Deutschland, die diese Ausbildung gemacht haben. 2015 haben wir die ersten Prüfungen bei Karen Lavie, einer niederländischen Querflötistin, ablegen können.“

Wie ist sie dazu gekommen, die von dem japanischen Geiger Shinichi Suzuki (1898 – 1998) ursprünglich für Streicher entwickelte Methode auf die Flöte anzuwenden? Und worum geht es in erster Linie: Um Drill und Hochbegabung? Schließlich sind mittlerweile viele Top-Geigerinnen wie Julia Fischer, Hilary Hahn oder Isabelle Faust, die nach der Suzuki-Methode gelernt haben, an die Weltspitze gelangt. „Anfangs hatte ich viele Vorurteile, was die Methode betrifft“, gibt Roscher zu, die sich für ihre Antwort Zeit lässt. „Als ich mich begann dafür zu interessieren, hatte ich mir auch viele alte Filme im Internet angesehen, auf denen zum Beispiel 50 kleine Japaner im Anzug in Reih und Glied auf der Violine dasselbe Stück spielen. Das sah für mich sehr nach ‚Drill‘ aus“, berichtet die 54-jährige Musikpädagogin, Kammermusikerin und freie Querflötistin, die große innere Entschlossenheit ausstrahlt.


Doch schon nach dem ersten Wochenende mit Karen Lavie seien ihre Vorurteile wie weggeblasen und alle Fragen ausgeräumt gewesen. „Suzuki hat gesagt, er möchte mit dieser Methode bessere Menschen ausbilden, nicht Spitzenmusiker um jeden Preis.“ Bei Suzuki lerne man grundsätzlich nach Gehör, nicht nach Noten. Das Besonders sei, „dass man bereits mit den Kleinsten beginnen kann. Vor meinem Suzuki-Wissen hätte ich vielleicht Eltern geraten, ihr Kind erst mit sieben oder acht anzumelden. Schließlich hätte ich gar nicht gewusst, wie man noch jüngere Kinder ab vier oder fünf Jahren altersgerecht an die Querflöte heranführt“, gibt Roscher zu. Die Ergebnisse seien beeindruckend: „Mir fällt auf, dass die Kinder, weil sie übers Gehör lernen und nicht von Anfang an gebeugt vor dem Notenständer stehen, insgesamt eine bessere Haltung haben und der Klang frei und schön aus ihren Flöten strömt.“ In der Grundschule würden sie dann mit dem Notenlesen beginnen, weil viele ja auch im Schulorchester spielen wollten. „Das Suzuki-Repertoire spielen wir aber weiter auswendig.“
Europaflaggen und „Ode an die Freude“
Britta Roscher leitet an diesem Juli-Wochenende gemeinsam mit ihrem italienischen Kollegen Marco Messina in Limburg die „Europäische Suzuki Querflöten-Convention“, bei dem 21 Lehrkräfte auf unterschiedlichem Ausbildungsniveau (es gibt fünf Levels) und 32 Schüler samt elterlichem Anhang aus allen Teilen Europas für drei Tage in der Limburger Jugendherberge musizierend zusammenkommen. Wie viele Nationen es tatsächlich sind, kann man an den Fahnen sehen, die gerade mit viel Eifer bei den „Pre-Marys“, den absoluten Anfängern, im Raum „Amaryllis“ geschwungen werden. Sie proben die europäische Hymne „Ode an die Freude“ Ludwig van Beethovens für das morgige Konzertfinale in der evangelischen Kirche an der Limburger Bahnhofstraße.

Lehrerin Ursula Olschina mahnt die Kleinsten sanft und bittet um ihre Mithilfe: „Wir wollen doch morgen Britta und Marco Dank sagen für ihre Arbeit.“ Gemeinsam mit Anastasiia Baturova aus der Schweiz schreiten sie die Reihen ab und schwenken dabei die Landesfahnen der Workshop-Lehrer: Estland, Frankreich, England, Niederlande, Spanien, Schweiz, Italien und Deutschland.
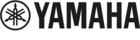

Zu Beginn der Stunde hatten die Kleinsten spielerisch am Ballmodell gelernt, wie die Atmung richtig sitzen muss, damit man an der Flöte klare Ton strömen lassen kann. Unter ihnen ist auch Julia Pfaff. Mutter Annalena ist mit ihr aus Erzhausen nahe Darmstadt angereist. Die 35-Jährige berichtet, dass sie selbst als Kind „normalen“ Klavierunterricht erhalten habe: „Aber, um ehrlich zu sein: Auch ich habe damals, obwohl ich die Noten klassisch lernen musste, immer schon stärker nach Gehör gespielt und tue das auch heute noch. Diese Unterrichtsmethode, die wir bei Frau Olschina an der privaten Jugendmusikschule in Erzhausen lernen, ist aber etwas ganz anderes. Sie ist unglaublich spielerisch und geht sehr gut auf die Bedürfnisse des Kindes ein. Das macht es so einfach! Nur daher hat Julia in kürzester Zeit so extreme Fortschritte gemacht.“
Es gehe um Nachahmen, um Bewegung, um Freude am Spiel. Für ihre Tochter bedeute das: „Ich habe Erfolgserlebnisse und werde nicht auf das, was ich falsch mache, reduziert. Ob hinterher aus Julia die beste Flötistin wird oder ob sie einfach Freude mit dem Instrument hat und ihr Selbstwert gestärkt wird, das werden wir dann sehen.“ Was sagt Julia selbst dazu? Was mag sie an der Querflöte? „Der Ton ist so schön“, antwortet sie verträumt. Hat sie ein Lieblingslied? Die Antwort der Sechsjährigen kommt prompt: „Mary hat ein kleines Schaf.“ Davon kann sie mit ihrem extra gebogenen Mundstück, das die Kleinen alle nutzen, um die lange Flöte zu verkürzen, bereits zwei Töne greifen und darf mit den Großen spielen, wenn sie das gesamte Lied intonieren.

Ursula Olschina unterrichtet Suzuki seit 2016 und gerät auf Nachfrage sofort ins Schwärmen: „Ich fand es immer so traurig, dass die Kinder durch das Notenlesen so gebremst werden. Die meisten können deshalb nicht so gelöst und flüssig spielen, wie sie möchten.“ Ist es nicht hinterher schwer sich umzustellen und die Noten noch zu lernen? „Das ist von Fall zu Fall ganz unterschiedlich. Die einen lernen das in der zweiten, dritten Klasse rasend leicht. Bei einem Jungen allerdings, der bis jetzt so wunderbar frei gespielt hatte, muss ich feststellen: Er kommt mit Noten überhaupt nicht zurecht. Mit der normalen Methode hätte er nie Freude am Querflötenspiel gehabt. Mit ihm mache ich es jetzt so: Er darf weiter viel mehr frei spielen als die anderen. Und an die Noten führe ich ihn ganz, ganz, ganz langsam heran.“


Suzuki als musikalische Muttersprache
Im nächsten Unterrichtsraum arbeiten Marco Messina und weitere italienische Lehrerinnen mit der großen Teenager-Gruppe. Komplexe Bach-Melodien und tänzerische italienische Barockmusik strömt aus 20 Querflötenkehlen durch den Raum und wer dabei an unsauberes Durcheinander denkt, wundert sich über die Reinheit und Präzision, mit der sie komplexe Literatur, teils unisono, rein nach Gehör memorieren. Sie stehen in stolzer Haltung im Raum und können sich beim Spielen sogar in die Augen sehen.
Eine Gruppe aus vier Schülern ist samt Lehrkraft aus Florenz angereist, Marco Messina mit elf weiteren aus Caserta, nördlich von Neapel. „Ich habe mir bereits im Alter von 25 Jahren die Suzuki-Methode für die Querflöte erschlossen, weil mich der Unterricht mit den Kleinsten besonders interessiert hat“, erinnert sich Messina. „Sie lernen es mit Suzuki intuitiv, wie eine musikalische Muttersprache.“ Der 55-Jährige ist in Italien nicht nur Suzuki-Pionier. Er ist auch einer der ganz wenigen, die selbst Suzuki-Lehrer ausbilden dürfen.

Seine eigene Lehrerin damals, die Niederländerin Anke van der Bijl, steht jetzt neben ihm und strahlt mit ihren 67 Jahren eine ansteckende Lebensfreude aus. In der Internationalen Suzuki-Hierarchie nimmt sie einen bedeutenden Platz ein. „Zum ersten Mal habe ich die Wirkung in Schottland 1990 bei der Internationalen Suzuki Conference in St. Andrews erlebt, bei der Suzuki-Interessierte aus der ganzen Welt zusammenkamen. Ich war berührt davon, wie hier auf einmalige Weise richtig mit Musik kommuniziert wird und habe mich gefragt: Gibt es so eine Methode auch für Querflöte?“


Damals habe sie den Suzuki-Flötisten Toshio Takahashi kennengelernt. Nachdem sie ihr Examen an der Utrechter Hochschule in Musikpädagogik abgelegt hatte, führte ihr weiterer Studienweg sie nach England, Finnland, Japan und in die Vereinigten Staaten. Allein sieben Mal reiste sie zum berühmten Takahashi, um seine Methode zu studieren. Seit 2001 ist sie Ausbilder-Lehrerin geworden und hat in vielen Ländern unterrichtet. Seit 2013 nimmt sie bei der Internationalen Querflöten Gesellschaft (ISA Flute Committee) den ehemaligen Platz Toshio Takahashis ein und ist zudem Vorsitzende der Europäischen Suzuki Gesellschaft (ESA) für alle 15 Instrumente. Sie lächelt, als sie konstatiert: „Das Wunderbare bei dieser Methode ist, dass die jetzt pubertierenden Querflötistinnen und Querflötisten, die vor zehn Jahren im Alter von drei, vier Jahren begonnen haben, durch das spielerische Erlernen per Gehör bereits ein so hohes Niveau erreicht haben, dass sie selbst in den frustrierenden Turbulenzen der Pubertät nicht aufhören zu spielen.“
Musik genießen wie Möwen, die nicht über ihren Flug nachdenken
Die Limburger Convention findet sie „eher klein“ und schmunzelt. Zum Vergleich: 2016 und 2023 hätten in der Londoner Royal Albert Hall 1.500 Kinder und Jugendlichen vor einem 9.000-köpfigen Publikum aus der ganzen Welt gespielt. Noch heute ist sie begeistert von dem, was sie gesehen hat: „Sie müssen sich vorstellen: Da stehen dann 1.500 Kinder, die Geige, Klavier, Harfe, Flöte oder Bratsche spielen, anderthalb Stunden üben und am Ende ein großes Programm bewältigen, darunter Felix Mendelssohn-Bartholdys berühmtes Violinkonzert – alles ohne Noten.“ Gemeinsam mit Toshio Takahashi und den vier Mitgliedern des ISA Flute Committees hat sie das in der gesamten Welt gültige Suzuki Querflöten-Repertoire zusammengestellt.

Es fängt mit Kinderliedern an und geht dann zu leichter Barockmusik über. Am Ende stehen die beiden Mozart Solo-Konzerte und schließlich das Flötenkonzert van Jacques Ibert. „Wir denken in Lehrzielen: Anfangs ist die Haltung wichtig, dann der Ton im unteren und mittleren Register. Danach gibt es eine lange Zeit, in der wir den Oktavwechsel C-D-E üben. Dann werden verschiedene Artikulationen wichtig und später kommt das hohe Register mit Dynamik, Intonation und Vibrato. Das übergeordnete Ziel heißt: Die Schönheit der Musik und das gemeinsame Musizieren genießen. So wie die Möwen oben am Himmel, die ihren Flug einfach genießen, ohne darüber nachzudenken, was ihr rechter oder linker Flügel genau macht. Die Eltern spielen in unserer Methode eine sehr wichtige Rolle. Darum versuchen wir im September einen Stundenplan zu gestalten, der allen Eltern und allen Schülern passt.“






